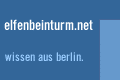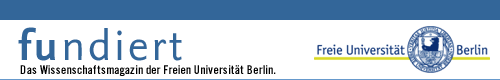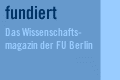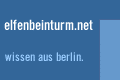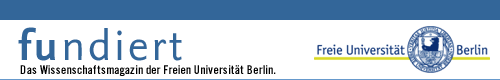| Foto: PhotoCase.de
Das hohe Alter
Mehr Bürde oder Würde
von Paul Baltes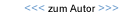
In der Wohlstandsgesellschaft werden immer mehr Menschen immer älter – und gewinnen im „jüngeren“ Alter auch an Lebensqualität. Doch umso schärfer offenbaren sich im hohen Alter die Grenzen der menschlichen Biologie: Prof. Paul B. Baltes, Direktor am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Honorarprofessor an der Freien Universität Berlin, fordert angesichts dieser Problematik, die Alternsforschung zu einem Eckpfeiler der Wissenschaft im 21. Jahrhundert zu machen.
In den letzten Jahrzehnten ist nicht nur die Lebenserwartung gestiegen, es wurde auch die Lebensqualität der älteren Menschen erheblich verbessert. Dazu haben Alternsforschung – Gerontologie – und Sozialpolitik sowie medizinische, kulturelle und ökonomische Fortschritte beigetragen. Doch inzwischen, da immer mehr Menschen 90 bis 100 Jahre alt werden, treten die Grenzen dieser Entwicklung zu Tage: Neueste Erkenntnisse zeigen, dass das Älterwerden der Ältesten der Alten auch künftig nicht nur mit Würden, sondern mit erheblichen Bürden einhergehen könnte.
Den Januskopf des Älterwerdens offenbart ein Vergleich zwischen dem „Dritten“ und dem „Vierten Alter“. Das Dritte Alter beginnt mit dem 60. Lebensjahr, das Vierte mit dem chronologischen Alter, zu dem die Hälfte der ursprünglichen „Geburts-Kohorte“ nicht mehr lebt – in den Industrieländern heute mit etwa 80 Jahren. Die guten Nachrichten der Wissenschaft gelten vor allem für das Dritte Alter und dessen Potenzial oder Plastizität. Im Vierten Alter hingegen offenbart sich unbarmherzig die biologische Unfertigkeit des Menschen – und derzeit spricht wenig dafür, dass ein solch hohes Alter gemeinhin zu einem „Goldenen Alter“ des Lebens werden könnte. So wie sie sich heute darstellt, wird die Zukunft des Vierten Alters unsere Gesellschaft vor schier unüberwindliche Probleme stellen – und das bedeutet eine Herausforderung für die Forschung.
Der Anstieg der Lebenserwartung im 20. Jahrhundert betrifft nicht nur die Jungen, sondern inzwischen auch die 80-, 90- und sogar 100-Jährigen. Ein 80-Jähriger hat heute in einer Industriegesellschaft noch eine statistische Lebenserwartung von acht Jahren – und damit doppelt so viel wie noch vor drei Jahrzehnten. Setzt sich der Anstieg der Lebenserwartung künftig quasi linear fort, dann wird fast die Hälfte der heute Geborenen an die 100 Jahre alt. Zwar leidet eine solche lineare Projektion am „Kurzblick der Gegenwart“ und ist daher unsicher. Dennoch zwingt sie die Gesellschaft, ernsthaft über die Zukunft nachzudenken.
Vorab zum heute so gern beschworenen Einfluss der Gene auf den Funktionsstatus alternder Menschen. Tatsächlich gibt es Gene, die für die Lebensspanne des Menschen bedeutsam sind. Doch der rapide Anstieg der Lebenserwartung im 20. Jahrhundert lässt sich nicht mit Veränderungen im menschlichen Genom begründen, da solche sehr viel langsamer vor sich gehen. Dass die Menschen in hoch entwickelten Ländern heute so viel länger leben, liegt an den in vielerlei Hinsicht verbesserten Lebensumständen – und darf als Erfolg der kulturellen und gesellschaftlichen Evolution gelten: Durch sie wurde all das ausgeschöpft, was an Plastizität im menschlichen Genom steckt.
Doch nicht nur die Lebenserwartung, auch die Lebensqualität der Älteren ist gestiegen. Die heute 70-Jährigen sind körperlich und geistig etwa so fit wie die 65-Jährigen vor 30 Jahren. Also haben die „jungen Alten“ etwa fünf „gute“ Lebensjahre dazu gewonnen. Außerdem ist der gesundheitliche Status älterer Menschen heute besser als der vergleichbarer Altersgruppen in früherer Zeit.
Dass auch der alternde Kopf noch über ein beträchtliches Potenzial verfügt, belegen Studien des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, die grundlegende Erkenntnisse über Intelligenz und Geist sowie deren Abhängigkeit vom Lebensalter brachten. Danach ist Intelligenz nicht als eine einzige, homogene Fähigkeit zu sehen. Sie umfasst zum einen die „fluide“ Mechanik des Geistes, die schiere Geschwindigkeit und Genauigkeit der Informationsverarbeitung – die in der Kindheit rasch wächst, doch schon vom frühen Erwachsenenalter an stetig sinkt. Weiteres Merkmal der Intelligenz ist die „kristalline“ Pragmatik, die kulturgebundenes Wissen und Denken widerspiegelt und auf Übung beruht: Zu ihr zählen Sprachvermögen, Fachwissen und soziale Kompetenz – Fähigkeiten, die bis ins hohe Alter erhalten bleiben können, sofern sie ausgeübt und nicht durch Krankheiten beeinträchtigt werden.
Die Stärken des Alters liegen vor allem in emotionaler Intelligenz und in Weisheit oder „Weisheitswissen“. Emotionale Intelligenz bezeichnet die Fähigkeit, Ursachen von Gefühlen wie Hass, Liebe oder Furcht zu verstehen und Strategien zu finden, durch die sich emotionale Konflikte vermeiden oder in ihren negativen Auswirkungen dämpfen lassen: Das gelingt älteren Menschen oft besser als jüngeren. Weisheitswissen kennzeichnet am eindrucksvollsten das geistig-persönliche Potenzial älterer Menschen. Weisheit bedeutet Wissen um die conditio humana, um die Vereinigung von Tugend und Wissen in der Gestaltung der Lebensführung. Altwerden allein genügt dafür freilich nicht; nur dann, wenn sich Lebenserfahrung mit bestimmten Persönlichkeitseigenschaften und Denkstilen verbindet, erzielen ältere Menschen überdurchschnittlich häufig Spitzenleistungen in Weisheitsaufgaben. Ähnliches gilt für bestimmte Bereiche der Kunst sowie der beruflichen Expertise. So zählen ältere Komponisten oder Dirigenten oft zu den besten und auch Fachwissen kann „alternsfreundlich“ wirken, solange der ältere Mensch beruflich aktiv bleibt.
Eine weitere Stärke des Alters liegt in der Pflege des Selbstbildes und der Lebenszufriedenheit. Es gelingt älteren Menschen überraschend gut, ihr Leben in einem immer engeren Umfeld und unter körperlichen Beeinträchtigungen so einzurichten, dass sie sich ein positives Selbstgefühl erhalten. Sie regulieren ihr subjektives Wohlbefinden, indem sie ihre Erwartungen an die Realität anpassen. So berichten viele ältere Menschen, obschon es ihnen objektiv körperlich weniger gut geht, von ebenso guter subjektiver Gesundheit wie Jüngere.
Diese „adaptive Ich-Plastizität“ wirkt auch in die alltägliche Lebensführung hinein. Das entspricht der so genannten Theorie der selektiven Optimierung mit Kompensation, entwickelt am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung: Sie gilt zwar für alle Phasen des Lebens, gerät jedoch im Alter oft zu einer wahren Lebenskunst. Ein Beispiel dafür lieferte der 80-jährige Pianist Artur Rubinstein, der auf die Frage, wie er es schaffe, noch in seinem Alter so hervorragende Konzerte zu geben, drei Gründe nannte: Erstens spiele er weniger Stücke – ein Beispiel für Selektion; zweitens übe er diese Stücke häufiger – ein Beispiel für selektive Optimierung; drittens schließlich setze er größere Kontraste in den Tempi, um sein Spiel schneller erscheinen zu lassen als er noch zu spielen imstande sei – ein Beispiel für Kompensation.
Wer auf solche Weise Selektieren, Optimieren und Kompensieren als Verhaltensstrategien einsetzt, fühlt sich besser und kommt im Leben weiter voran – besonders dann, wenn wie im Alter weniger Ressourcen zur Verfügung stehen.
Derlei positive Erkenntnisse über das Alter und dessen Potenzial versetzten Gerontologen und Gesellschaftspolitiker in eine Art Aufbruchstimmung: Der gesellschaftliche Fortschritt, so dachten viele, würde auch dem Alter eine goldene Zukunft bescheren. Doch nicht alle, und vor allem nicht die Betroffenen selbst, teilten diese Zuversicht: Warum sonst, so ihre Frage, wollen zwar die meisten gern alt werden, aber nicht alt sein? Und warum wollen Menschen mit zunehmendem Alter relativ gemessen doch immer jünger sein? Der italienische Philosoph Bobbio schrieb in seinem Alterswerk von „Happy Gerontology“ und führte den übersteigerten Optimismus darauf zurück, dass viele Gerontologen dem Alter noch nicht ins Gesicht geschaut hätten.
Doch das wurde inzwischen nachgeholt. Seit gut zehn Jahren widmet sich die Gerontologie verstärkt den Ältesten der Alten – und so entstand auch die international wegweisende „Berliner Altersstudie“, erarbeitet unter wesentlicher Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Diese Studie erfasste den Altersbereich von 70 bis über 100 Jahren und war einzigartig in ihrer interdisziplinären Ausrichtung: Mehr als 50 Mediziner, Psychologen, Soziologen und Ökonomen trugen zu ihr bei und untersuchten die mehr als 500 Teilnehmer über fast 10 Jahre jeweils an fünf aufeinander folgenden Zeitpunkten.
Dabei bestätigte sich, was Bobbio vermutet hatte: dass der Optimismus bezüglich des hohen Alters hinterfragt werden muss. Zwar findet man auch unter den Ältesten einige, die auf einem guten Funktionsniveau agieren, doch mit steigendem Alter werden das rasch weniger. Denn körperliche und physische Funktionen geraten in hohen Jahren immer stärker aus dem Tritt – entgegen dem überkommenen Bild, wonach jene, die lange leben, von den negativen Erfahrungen des Alters verschont bleiben könnten. Die „risques heureux“ des guten Dritten Alters geraten im Vierten Alter für fast alle zu „risques malheureux“.
Das äußert sich zunächst in einem deutlichen Verlust an Lernpotenzial, wie Tests mit einer bestimmten Gedächtnis-Technik, der „Methode der Orte“, erbrachten: Dieses Trainingsprogramm erwies sich bei jüngeren Alten als sehr wirksam, doch unter den Personen jenseits von 85 waren viele nicht mehr imstande, sich diese Technik anzueignen. Dabei waren manifest an Demenz Erkrankte von diesem Test ausgeschlossen. Das harte Fazit: Auch mental „gesunde“ Hochbetagte sind extrem beeinträchtigt, was das Erlernen neuer Inhalte angeht.

Dazu kommt, dass im Vierten Alter die Persönlichkeit und das Ich weitaus anfälliger sind als bei jüngeren Alten, die sich Dank ihrer psychischen Regulationskraft im Durchschnitt denselben Grad an Wohlbefinden bewahren wie jüngere Menschen. Im hohen Alter stößt diese adaptive Ich-Plastizität an Grenzen und Indikatoren des Wohlbefindens wie Lebenszufriedenheit, soziale Eingebettetheit, positive Lebenseinstellung und Alterszufriedenheit sinken deutlich.
Viele weitere medizinische, psychologische und soziale Parameter weisen für die Ältesten der Alten beträchtliche Verluste aus: Jenseits von 85 Jahren liegt die Zahl derer, die unter chronischen Belastungen leiden und niedrige Funktionswerte zeigen, fast fünfmal höher als bei den 70- bis 85-Jährigen. Diese Daten belegen, dass der Lebensweg im hohen Alter zunehmend zum Leidensweg gerät, da die Grenzen der menschlichen Anpassungsfähigkeit erreicht und oft auch überschritten werden. Dass die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit älterer Menschen in neuerer Zeit erheblich verbessert wurde, kann diese negativen Folgen des hohen Alters allenfalls mildern, doch nicht ausgleichen.
Das gilt vor allem für den dramatischen Anstieg an Demenzen, den auch die Berliner Altersstudie bestätigt: Danach leiden unter den 70-Jährigen weniger als fünf Prozent an einer Form von Demenz, unter den 80-Jährigen zwischen 10 und 15 Prozent – doch unter den 90-Jährigen bereits jeder Zweite. Demenzen, insbesondere die Alzheimer-Demenz, bedeuten den schleichenden Verlust vieler Grundeigenschaften des Homo sapiens wie etwa Intentionalität, Selbstständigkeit, Identität und soziale Eingebundenheit – Eigenschaften, die wesentlich die menschliche Würde bestimmen und es dem Individuum ermöglichen, seine „Menschenrechte“ autonom auszuüben. Für die Alzheimer-Demenz gibt es noch keine wirksame Prävention oder Therapie. Die beste Vorbeugung, das mag zynisch klingen, besteht derzeit darin, nicht in die Jahre des Vierten Alters hineinzuleben.
Angesichts dieser Tatsachen stellt sich eine neue und beängstigende Herausforderung: die Erhaltung der menschlichen Würde in den späten Jahren des Lebens. Gesundes und menschenwürdiges Altern hat seine Grenzen – und das Leitmotiv der Gerontologie „Add more life to years, not more years to life“ scheint im hohen Alter immer weniger umsetzbar.
Auch theoretische Gründe sprechen gegen eine mögliche Optimierung des ältesten Alters. Sie liegen in der evolutionär bedingten fundamentalen „Unfertigkeit“ der biologisch-genetischen Architektur des Menschen. Man könnte sagen: Die Evolution stand dem Alter eher gleichgültig gegenüber, sie selektierte und optimierte vielmehr die Reproduktionsfähigkeit des Menschen im frühen Erwachsenenalter. Deshalb verliert das menschliche Genom seine „ordnende Hand“ zunehmend, wenn es um die höchste Altersstufe geht – es wird fehlerhaft, büßt an Regulationskraft ein, und die in ihm angelegte biologische Plastizität und Präzision schwinden. Erst die kulturelle Evolution – mit Fortschritten in Bildung, Medizin und Wirtschaft – schuf die Voraussetzungen dafür, die im menschlichen Genom verankerte Plastizität voll auszuschöpfen.
Um dem Menschen mit seiner weitgehend konstanten genetischen Ausstattung ein durchschnittlich längeres Leben zu ermöglichen, ist ein stetes Mehr an kultureller Entwicklung nötig. Und eben darin liegt das Dilemma: Weil sich die biologischen Potenziale mit dem Alter erschöpfen, verlieren auch die kulturellen Stützen an Wirkung – gerade im höheren Lebensalter, das immer mehr kulturelle Intervention erfordert. So benötigen Ältere sehr viel mehr an kognitiver Übung, um ähnliche Leistungsfortschritte wie junge Menschen zu erzielen. Und die Fähigkeit, neue Wissens- und Denkkörper zu erwerben, ist im hohen Alter eng begrenzt.
Inwieweit man angesichts dieses Dilemmas auf die Wissenschaft zählen kann, ist heute eine der Kernfragen der Gerontologie. Die biologisch-medizinische Forschung nährt die Hoffnung, man könne das Vierte Alter ebenso verbessern wie einst das Dritte. Doch da ist nicht nur Optimismus, sondern auch Skepsis angebracht – denn die Plastizität im hohen Alter ist grundlegend eingeschränkt, kaum vorherzusagen und weniger durch interne oder externe Faktoren zu beeinflussen.
Man könnte hoffen, auf genetischer Ebene die evolutionär begründete und deshalb „alternsunfreundliche“ biogenetische Architektur des Lebensverlaufs so zu verändern, dass sie kulturellen und psychologischen Einflüssen besser zugänglich wird. Doch solche Spekulationen führen auf ein noch höchst unsicheres Terrain – nicht nur der Forschung, sondern auch der ethisch-religiösen Diskussion über die Natur des Menschen. Schon rein wissenschaftlich ist die gentechnische Option mit Fragezeichen behaftet, bedingt durch die Komplexität des menschlichen Genoms: Versuche, in dieses hochvernetzte System einzugreifen, bergen die Gefahr unvorhersehbarer Nebenwirkungen. Dazu kommt, dass der Altersprozess und viele seiner Leiden auf einer Vielzahl biogenetischer Ursachen und deren Wechselspiel mit zahlreichen Verhaltens- und Umwelt-Parametern beruhen: Damit liegen die Dinge hier grundsätzlich anders als bei den „einfacheren“ monogenetisch bedingten Leiden, für die man derzeit gentherapeutische Ansätze sieht – die aber demografisch relativ unbedeutend sind und nur einen Bruchteil der alternden Bevölkerung betreffen.
So sind denn auch viele Biomediziner der Meinung, die am Altern beteiligten genetischen Faktoren seien zu komplex und individuell zu unterschiedlich, um rasche und allgemeingültige Wege zur „künstlichen“ Vollendung der biokulturellen Architektur des Lebensverlaufs zu bieten. Dennoch, ungeachtet dieser skeptischen Sicht: Nur die Biomedizin wird auf lange Frist die wichtigsten Hilfen zur Transformation des hohen Alters in eine belle époque des Lebens liefern können. Mit der Verbesserung von Umweltbedingungen oder der Vermittlung von alternsfreundlichen Verhaltensstrategien allein ist dieses Ziel nicht zu erreichen.
Die Zukunft ist das Alter: Deshalb muss unter dem gesellschaftlichen Aspekt die Alternsforschung einen der Eckpfeiler der Wissenschaft im 21. Jahrhundert bilden. Das hat man in den USA bereits erkannt: Dort fließen jährlich aus öffentlichen Mitteln etwa zwei Milliarden Dollar in die Alternsforschung. Dazu kommt aus privatem Sektor eine geschätzte weitere Milliarde. Das macht drei Milliarden Dollar pro Jahr für die Alternsforschung – eine Summe, größer als der jeweilige gesamte Forschungshaushalt etwa der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder der Max-Planck-Gesellschaft.
In Deutschland besteht – trotz einiger exzellenter Forschungsgruppen – auf gerontologischem Feld ein massiver Nachholbedarf. Hier gilt es zu handeln. Denn der Beitrag der Wissenschaft zum Gesamtwohl des Landes wird künftig auch an dem gemessen werden, was sie für das Wohlergehen im Alter geleistet hat: Man wird fragen, ob sie die Erkenntnisse erarbeitet und bereit gestellt hat, die es erlauben, das Dritte Alter zu optimieren und die „risques malheureux“ des Vierten Alters zu mindern.
Welche Forschungswege dabei den größten Erfolg versprechen, darüber wird international heiß diskutiert. Es geht entscheidend darum, neben den guten Nachrichten über das Potenzial des Dritten Alters auch die schlechteren über die Verletzlichkeit und Widerborstigkeit des Vierten Alters im Auge zu behalten: „Hoffnung mit Trauerflor“ wäre vielleicht das Motto, das dieser Situation entspricht.
Alter und Altern sind untrennbar mit biogenetisch-medizinischen, psychischen, sozialen, technologischen und gesellschaftlichen Problemen verquickt – und erfordern dementsprechend interdisziplinäre Forschung. Außerdem unterscheidet man in der Gerontologie zwischen normalem, optimalem und pathologischem Altern, woraus zwei verschiedene Ansätze erwachsen. Der erste gilt dem normalen Alternsprozess und dessen Verbesserung durch medizinische, psychologische, technische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Hilfen. Dieser Ansatz geht von den optimistischen Befunden zum Dritten Alter sowie von der Idee aus, dass es bei der derzeitigen Lebenserwartung mehr auf die Qualität des Lebens als auf dessen Verlängerung ankommt.
Der zweite Forschungsweg muss auf die pathologischen Begleiterscheinungen des Alters zielen. Es gilt, das Vierte Alter durch Vorsorge und Therapie von seinen schlimmsten Übeln, wenn nicht zu befreien, so zumindest zu entlasten. Das betrifft insbesondere die verschiedenen Demenzen, desgleichen aber das im Alter immer häufigere Zusammenwirken unterschiedlicher Erkrankungen. Dafür hat der Mediziner James Fries in Stanford das interessante Modell der „Compression of Morbidity“ entworfen: Wenn die Lebensdauer biologisch fixiert ist, dann sollte man danach trachten, alle altersbedingten Krankheiten und Beschwerden in ihrem Auftreten und in ihrer Ausprägung so zu verzögern, dass sie in ihrem Vollbild auf ein Zeitfenster jenseits des „natürlichen“ Todes verschoben werden. Das würde eine „compression“, eine Verdichtung der Krankheiten auf die letzten Lebensjahre bedeuten – eine Vision, die angesichts des gegenwärtigen Wissens durchaus plausibel erscheint.
Auch die Wirtschaft, darf man vermuten, wird einen Aufbruch in die Alternsforschung begrüßen. Dafür sprechen – neben der Tatsache, dass auch Wirtschaftsführer länger und länger besser leben wollen – zwei ökonomische Gründe. Zum einen hat das Alter, gesellschaftlich gesehen, das Potenzial zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor, namentlich in einer Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft. Man muss dafür nur das halb volle statt des halb leeren Glases sehen – und das Alter nicht nur als Belastung, sondern als Antrieb für Entwicklung und Fortschritt betrachten: Der gerontologische Sektor der Dienstleistungen erscheint dann als Motor einer künftigen Gesellschaft.
Zum anderen sollte man das Humankapital des jungen Alters würdigen, das gegenwärtig weitgehend brach liegt. Dieses Kapital könnte in der zahlenmäßig immer weiter schrumpfenden Generation der Jüngeren eine Hochkonjunktur auch im ökonomischen Bereich erleben. Dafür genügt es allerdings nicht, die Lebensarbeitszeit zu erhöhen, etwa auf 67 Jahre. Das ist zwar ökonomisch richtig – doch wird diese Option nur dann angenommen, wenn gleichzeitig eine „Kultur der Arbeit im Alter“ entwickelt wird. Über rein ökonomisch kalkulierte Maßnahmen und Reparaturen am bestehenden System ist eine solche Kultur nicht zu etablieren: Hierzu bedarf es einer grundlegenden, das heißt einer interdisziplinär fundierten und informierten Reform, zu der die Gerontologie wesentliche Beiträge liefern könnte.
Gesünder und aktiver zu altern, muss zur Zukunft unserer Gesellschaft gehören. Auf dem Weg vom Dritten in das Vierte Alter gibt es Not; doch dort liegen auch Chancen. Und diese Chancen zu nutzen, verlangt zunächst mehr Forschung. Andernfalls siegt künftig die Not – und dann sind alle, Alt und Jung, die Verlierer.
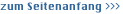
|