|
Herzlichen Dank !
Die Redaktion von fundiert dankt den Kinder der Kinderkardiologie des Deutschen Herzzentrums Berlin und den Kindern der Eltern-Kind-Gruppe der Evangelischen Markus-Gemeinde in Berlin-Steglitz für die Bilder, die sie zur Illustrierung dieses Artikels gemalt haben.
„Ganz normal – bis auf die Tablettenpause immer dazwischen”?
Über die Lebenssituation herztransplantierter Jugendlicher und deren Eltern
Dipl.-Psych. Peri Terzioglu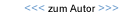
Mit einem fremden Organ zu leben, kann eine große psychische Belastung bedeuten, denn Transplantierte bleiben chronisch krank. Zeitlebens müssen sie Immunsuppressiva einnehmen und täglich ihren Gesundheitszustand überprüfen. Trotzdem können Abstoßungsreaktionen, Infektionen oder Sekundärerkrankungen auftreten. Ein Team von Psychologinnen, Ärzten und Ärztinnen der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin untersuchte, wie herztransplantierte Jugendliche und deren Eltern mit dieser Belastungssituation umgehen und sich selbst sowie ihr soziales Umfeld nach dem Eingriff wahrnehmen. Dipl.-Psych. Peri Terzioglu schildert in ihrem nachfolgenden Beitrag einige wesentliche Ergebnisse.
Die Auswirkungen chronischer Krankheit auf die Familie sowie auf die Lebensqualität und die psychosoziale Entwicklung der betroffenen Jugendlichen sind in zahlreichen Studien untersucht worden. Besonders Bereiche wie die Entwicklung einer sicheren Identität und eines positiven Körperbildes, die Integration in die Gleichaltrigengruppe sowie die Entwicklung von Autonomie mit Loslösung vom Elternhaus sind durch die krankheitsbedingten Einschränkungen betroffen. Darüber, wie sich Herztransplantationen diesbezüglich auswirken, ist bisher in einem geringen Ausmaß geforscht worden.
Im Rahmen eines zweijährigen Forschungsprojektes1 haben wir problemzentrierte Interviews mit sechs herztransplantierten Jugendlichen und deren Eltern sowie mit Ärzten und Psychologen aus dem Transplantationsbereich geführt. Die ausgewählten Jugendlichen waren zwischen 12 und 18 Jahren alt. Der Abstand zur Transplantation betrug ein bis drei Jahre.
1 Gefördert im Rahmen des Programms Berlin-Forschung, 10/1997-09/1999, Projekt 7/97, Titel: „Biographische Konzepte und Lebensqualität von Jugendlichen nach Herz- bzw. Lebertransplantation”, Projektbetreuung: Prof. Dr. med. Ulrike Lehmkuhl, Prof. Dr. Jörg M. Fegert, Dr. med. Margot Völger, Projektmitarbeiterinnen: Dipl.-Psych. Peri Terzioglu, Dipl.-Psych. Bärbel Mielke-Egelhofer
Das Streben nach Normalität
In den Experteninterviews mit Ärzten gewannen wir den Eindruck, das Leben herztransplantierter Jugendlicher verlaufe fast wie das gesunder Jugendlicher. Die Beschreibung sogenannter „guter Verläufe” wurde immer wieder als Argument für den Eingriff herangezogen, und es wurde uns an vielen Beispielen deutlich gemacht, wie „normal” das Leben nach einer Transplantation sei. Bei den Experten herrschte Übereinstimmung darin, dass die Jugendlichen nach Überstehen der akut postoperativen Phase bald ein körperliches Leistungsniveau erreichten, das dem gesunder Gleichaltriger sehr nahe komme – allerdings unter dem Vorbehalt, dass keine außergewöhnlichen organischen Komplikationen auftreten. Die meisten transplantierten Jugendlichen seien in der Lage, aktiv am normalen Leben teilzunehmen, und auch in der Schule gebe es kaum Schwierigkeiten.
In den Familien der Jugendlichen bot sich uns ein Bild, in dem – weit über das bloße Erhalten des Lebens hinausgehend – die betroffenen Jugendlichen offenbar ein Leben ohne große Einschränkungen führten.
Befragt nach seinem typischen Tagesablauf berichtete ein Junge:
„aufstehen, duschen, frühstücken, Medikamente nehmen, Schulranzen richten. Dann: Schule. Mittags nach Hause, essen, ein bisschen lernen und dann noch die anderen Medikamente nehmen und dann – ich mache, was der Tag bringt. Also: rausgehen, kicken, mit Kumpels irgendwo hin- gehen. Und abends wieder Tabletten nehmen, noch fernsehen, waschen und ins Bett. Ganz normal – bis auf die Tablettenpause immer dazwischen.”

Insgesamt hatte keiner der von uns befragten Jugendlichen gravierende Komplikationen bei der Operation und auch der postoperative Verlauf war bei allen regelhaft. Zu Routineuntersuchungen mussten die Jugendlichen nur noch in halb- bzw. ganzjährigen Abständen. Die Anzahl der täglich einzunehmenden Medikamente hatte sich bei den meisten Jugendlichen inzwischen auf eine vergleichsweise geringe Dosis reduziert. Alle von uns befragten herztransplantierten Jugendlichen gingen in Regelschulen und hatten durch den Eingriff oft kaum mehr als drei Wochen Schulunterricht verpasst. Sie waren in der Lage, in Maßen Sport zu treiben – die einzige Einschränkung war hier das Schwimmen in öffentlichen Bädern, da die Infektionsgefahr dort zu hoch ist. Zwei Familien lebten sogar mit Haustieren zusammen, eine Tatsache, die nicht selbstverständlich ist, da aufgrund der verminderten Immunabwehr der Jugendlichen eher versucht wird, Quellen der Infektion zu reduzieren.
Bei der genaueren Auswertung der Interviews mit den Jugendlichen deutete sich allerdings an, dass sich hinter der Fassade der Normalität Unsicherheiten und Ängste verbargen. Am Gravierendsten zeigte sich der Unterschied zu einem Leben als gesunder Jugendlicher in der Auseinandersetzung der transplantierten Jugendlichen mit der Möglichkeit des eigenen Todes. Allen befragten Jugendlichen war bewusst, dass sie ohne die Transplantation gestorben wären, wie die Aussage eines Mädchens verdeutlicht:
„Wenn ich nicht transplantiert werde, kann es sein, dass ich dann sterbe, und wenn ich transplantiert werde, dann bleibe ich am Leben. So dass sie mir gesagt haben, ob ich das alte Herz behalten will, oder ob ich das neue kriegen möchte. Da hab‘ ich gesagt: das Neue. Weil ich will ja nicht sterben.”
Gleichzeitig wussten die Jugendlichen, dass eine Abstoßung des Spenderorgans auch Jahre nach der Transplantation jederzeit auftreten kann und lebensbedrohliche Komplikationen mit sich bringen würde.
Mädchen: „(...) habe ich den gleichen Traum, der immer wieder kommt. Dass es denn nochmal sein müsste, mit der Transplantation und alles so. Und dass da was schiefgehen könnte.”
Die Routineuntersuchungen, die meist in jährlichen Abständen stattfinden, wurden von allen Jugendlichen als sehr angstbesetzt geschildert, selbst dann, wenn sie sich körperlich gut fühlten und äußerlich kein Anlass zur Sorge bestand. Für die transplantierten Jugendlichen bestand außerdem die Notwendigkeit, das Organ eines fremden Menschen, der gestorben ist, in das Selbstbild zu integrieren – und das in einer Lebensphase, in der die Herausbildung einer sicheren Identität eine wichtige Entwicklungsaufgabe darstellt. Die symbolische Besetzung des Herzens als Sitz der Gefühle und der Persönlichkeit stellte dabei eine zusätzliche Belastung dar. Von vielen Jugendlichen wurden in den Interviews Phantasien über die Identität des Spenders und den Einfluss des fremden Organs auf ihre Persönlichkeit thematisiert.
Junge: „(...) ich frage mich immer, was er so gemacht hat den ganzen Tag. Ob er ähnlich war wie ich oder so (...).”
Auch die Frage, welches Geschlecht der Organspender gehabt hat, war für die Jugendlichen von großer Bedeutung. Ein Junge befürchtete, das Organ eines homosexuellen Mannes erhalten zu haben und dadurch selbst homosexuell geworden zu sein.
Auffällig war auch, dass uns alle Jugendlichen ihre Vermutungen darüber mitteilten, von wem ihr Organ stammt. Grundlage für ihre Vermutungen waren teilweise die Verkehrsnachrichten, in denen am Tag ihrer Transplantation über Autounfälle berichtet wurde, bei denen Kinder oder Jugendliche ums Leben gekommen waren.
Zentral für das Jugendalter ist die Aufnahme von Beziehungen zu Gleichaltrigen außerhalb der Familie. Dabei wird eine Konformität mit der Peer group angestrebt. Die herztransplantierten Jugendlichen befanden sich aber aufgrund ihrer Biographie und der Anforderungen, die die Krankheit auch nach der Transplantation an sie stellte – z.B. Medikamenteneinnahme, das Verbot, in Freibäder zu gehen etc. – in einer Außenseiterposition und mussten zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um wenigstens äußerlich das Leben „normaler” Jugendlicher führen zu können.
Die geringe Anzahl gleichaltriger Transplantierter machte es für diese Jugendlichen schwer, „Leidensgenossen” in ihrer näheren Umgebung zu finden, von denen sie entsprechendes Verständnis für ihre Situation erwarten konnten:
Interviewerin: „Wenn ein Freund von dir transplantiert werden müsste, was würdest du dem raten?”
Junge: „Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen fies, aber ich würde mich vielleicht irgendwie freuen, dass ich nicht der einzige bin, den ich kenne, der so was erlebt. Aber ich wünsche es keinem.”
Ein Mädchen sagte über ihre Mitschüler:
„Die sollen mal selber in so eine Situation kommen. Dann wüssten die das, wie mir das gegangen ist.”
Ein Junge beschrieb das Verständnis seiner Freunde für seine Transplantation so:
„Die wissen ja nicht mal, wie man Transplantation schreibt!”
Einige Jugendliche berichteten auch über direkt ablehnende Reaktionen aus der Umwelt, wie folgendes Zitat veranschaulicht:

Mädchen: „(...) da ärgern mich die Jungs immer (...). Die sagen immer Schweineherz (...) weil ich ´n neues Herz habe (...). Ich finde das irgendwie gemein (...). Sie wissen ja gar nicht, was alles geschehen ist (...). Die erzählen bestimmt nur Lügen!”
Zwei Jungen berichteten über soziale Ausgrenzung als Folge der Medikamente, die sie einnahmen: zum einen Cortison-Tabletten, die zu einer starken Gewichtszunahme führen, zum anderen Immunsuppressiva, deren Einnahme notwendig ist, um eine Abstoßung des Spenderorgans zu verhindern:
Junge: „Zum Beispiel ich bin dann mal mit meinem Freund zu McDonalds gegangen, klar, die haben mich alle angeguckt: ja, ja muss die fette Sau da noch zu McDonalds oder so.”
Junge: „Die haben gesagt, dass ich immer denn so nach den Tabletten stinke. So aus´m Mund raus.”
Interviewerin: „Und was sagst du denn?”
Junge: „Na, ich kann doch nichts dafür. Das sind die Scheißtabletten. Die riechen immer.”
Es wird deutlich, dass den jugendlichen Transplantierten eine soziale Integration in die Gruppe der Gleichaltrigen infolge der Erkrankung erschwert war und somit eine wichtige Entwicklungsaufgabe des Jugendalters, die Loslösung vom Elternhaus, nur eingeschränkt erfolgte. Für diese Annahme spricht auch, dass nur einer der von uns befragten Jugendlichen sehr optimistisch über seine Lebenssituation berichtet hat. Er setzte sich aktiv mit seiner Krankheit auseinander und war sich seiner Sonderstellung im positiven Sinne bewusst. Seinerseits versuchte er, sich die soziale Umwelt auf seine Bedürfnisse einzurichten. Bei diesem Jugendlichen fanden wir eine außergewöhnlich hohe Bezogenheit vor allem der Mutter auf ihn. Sie machte ihm immer wieder deutlich, welche zentrale Rolle er für sie hat und dass ihm seine kämpferische Persönlichkeit bei der Bewältigung der Transplantation geholfen hätte. So hilfreich diese hohe Aufmerksamkeit der Mutter ihm offenbar einerseits war, so sehr könnte sie ihm die Loslösung vom Elternhaus später erschweren.

Die ständige Angst der Eltern um das Leben ihrer transplantierten Kinder
Selbst bei gutem postoperativem Verlauf war die Lebenssituation der Eltern in hohem Maß von der Angst um das Leben ihrer Kinder geprägt, wie beispielhaft das Zitat einer Mutter verdeutlicht, die sich nicht sicher war, wie alt ihre Tochter mit dem Spenderherz werden könne, „denn schließlich ist es noch nicht mal ihrs, sie ist nicht mit dem Ding groß geworden.” Aber sie hoffte, dass „sie noch ein paar Jahre hat.”
Die Angst vor der plötzlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes ihrer Kinder drückte sich bei fast allen befragten Eltern darin aus, dass sie aufmerksam jegliche Veränderung in deren Befinden registrierten und täglich deren Blutdruck maßen. Das IMEG-Gerät, ein Gerät zur Überwachung der Herzfrequenz, das direkt mit der Transplantationsklinik verbunden ist und das sich die Jugendlichen nachts anlegen, vermittelte ihnen ein Gefühl relativer Sicherheit.
Urlaube wurden von den meisten Familien kaum noch unternommen bzw. nur dorthin, wo die Transplantationsklinik notfalls schnell erreichbar war. Bei den Eltern bestand eine massive Unsicherheit darüber, wie ein Leben zu gestalten sei, das in ausreichendem Maße die Anforderungen der Krankheit berücksichtigt und gleichzeitig das Kind nicht ausschließlich auf die Krankheit fixiert. Ein Beispiel dafür war die offenkundige Schwierigkeit der befragten Eltern, von den Kindern Leistungen zu fordern.
Vater: „Was ist eigentlich wichtig für ihn? Ist Schule wichtig für ihn? Ist sein Berufsleben wichtig für ihn? Muß man da überhaupt mit Gewalt drauf hinarbeiten?”
Alterstypische und in der Entwicklung von Jugendlichen durchaus normale familiäre Konflikte zwischen Eltern und Jugendlichen wurden von den Eltern oft auf die Krankheit zurückgeführt. Dies führte bei einigen Eltern zu einer extremen Nachgiebigkeit.
Mutter: „Er weiß, daß er krank ist, und wenn er dann bohrt und will das und das, kriegt er es meistens.”
Bei anderen führte die Befürchtung, das Kind würde seine krankheitsbedingte Sonderstellung in der Familie ausnutzen, zu einer unangebrachten Rigidität und Härte im Erziehungsstil.
Unsicherheit bestand bei den Eltern auch darin, wieviel Normalität sie ihrem eigenen Leben zugestehen wollten – losgelöst von der Fürsorge für ihr Kind.
Mutter: „Man muss immer nur zuerst an ihn denken. Weiter geht’s gar nicht. Man denkt immer erst an ihn: Können wir das machen? Hält er das durch? Nur immer er zuerst.”
Die Fähigkeit der Eltern, ein vernünftiges Maß an Verantwortung für ihr Kind in bezug auf die Krankheit zu übernehmen, d.h. die Anforderungen der Krankheit weder zu ignorieren noch das gesamte Familienleben auf die Erfordernisse des kranken Jugendlichen auszurichten, schien u.a. von folgenden Faktoren abzuhängen:
- Dauer, Art der Vorerkrankung des Kindes
- Verlauf der Transplantation
- persönliche und materielle Ressourcen der Familie
- Ausmaß des Wissens über die Krankheit
- Verfügbarkeit eines stützenden sozialen Netzes außerhalb der Klinik
- Ausmaß der Abhängigkeit von den Ärzten auch nach dem Klinikaufenthalt.
Die Relevanz von Wissen über die Krankheit
Für medizinische Laien sind die Implikationen der Transplantation schwer zu verstehen. Die Eltern der betroffenen Jugendlichen waren deshalb in besonderem Maß auf die Darstellungen und Einschätzungen der Ärzte angewiesen, wobei hier oft Verständigungsbarrieren bestanden:
Mutter: „Ich musste meinem Mann auch immer übersetzen (...). Das merken viele Ärzte gar nicht, dass sie manchmal die Patienten damit [lateinische Fachbegriffe] überschwemmen (...). Mein Mann, der hat´s nicht verstanden.”
Hilfreich war, wenn Eltern – wie die eben zitierte Mutter – selbst eine medizinische Ausbildung absolviert hatten. Auch diejenigen, die sich autodidaktisch über die Erkrankung und die Transplantation informiert hatten, konnten die Ärzte besser verstehen.
Aus manchen Elterninterviews entstand außerdem der Eindruck, dass die behandelnden Ärzte die langfristigen Konsequenzen der Transplantation beim Aufklärungsgespräch nicht ausführlich thematisiert hatten. Folglich interpretierten manche Eltern die Transplantation als ein punktuelles Ereignis, so als wäre nach der ersten turbulenten postoperativen Zeit ein relativ normales Leben endlich oder wieder möglich. Zu dieser Fehleinschätzung trug auch bei, dass einige Eltern sich mit bestimmten, vor allem ängstigenden Informationen vor der Transplantation nicht auseinandersetzen wollten.
Vater: „Wie das abläuft, das hat uns keiner gesagt. Das wollten wir aber auch nicht wissen.” Mutter: „Nee, das hätte mich total fertig gemacht, wenn ich gewusst hätte, was er da für ´ne lange Narbe hat (...).”
Mutter: „[Vor der Transplantation ] war ich froh, dass ich nichts wusste (...). Das ist logisch, das kann ich mir an zwei Fingern ausrechnen, dass es schiefgehen kann. Aber ich wollte nicht wissen, wie hoch die Quote liegt (...).”

Gering war auch die Bereitschaft der Eltern, vor der Transplantation auf Selbsthilfegruppen zuzugehen, um von anderen Betroffenen zu erfahren, was eine Transplantation für das weitere Leben bedeutet. Hier spielte vor allem die oben dargestellte Angst vor negativen Informationen, aber auch die mangelnde Erreichbarkeit von Selbsthilfegruppen außerhalb von Großstädten eine Rolle.
Soziale Isolation der Familien und die zentrale Bedeutung der Ärzte in der Transplantationsklinik
Für die Bewältigung der Transplantation ist das Ausmaß und die Art der verfügbaren sozialen Unterstützung wichtig. Während des Krankenhausaufenthalts waren vor allem die Ärzte für die Eltern die Hauptbezugspersonen und Quelle sozialer Unterstützung, da diese ihnen Mut machten, das Wagnis der Transplantation einzugehen und die Anforderungen der ersten postoperativen Zeit zu erfüllen. Gespräche mit psychologischen oder kirchlichen Mitarbeitern der Klinik wurden demgegenüber von den Eltern weniger gesucht, da für sie in diesem Stadium der Behandlung vor allem die medizinische Versorgung im Vordergrund stand.
Verstärkt wurde die emotionale Fixierung der Familien auf die Ärzte noch durch die hohe Aufmerksamkeit und Zuwendung, die ihnen die Ärzte während des Transplantationsprozesses zuteil werden ließen.
Mutter: „Als fremde Person wirst du da gleich aufgenommen, als wenn du, ja, so, als wenn die dich schon ein paar Jahre kennen!”
Viele Eltern betonten, dass ihre Familie eine besonders persönliche Behandlung durch die behandelnden Ärzte erfahren hätte. Beispielhaft sei hier ein Elternpaar genannt, das hervorhob, dass der behandelnde Arzt wegen der plötzlichen Transplantation ihres Sohnes seine eigene Geburtstagsfeier abgesagt habe und deshalb gleich nach dem Aufwachen des Jungen aus der Narkose für ihn da sein konnte.
Die zentrale Stellung der Ärzte wurde gestärkt durch die mangelnde Verfügbarkeit anderer Quellen sozialer Unterstützung wie Familie und Freunde. Die Eltern verbrachten viel Zeit im Krankenhaus bei ihren Kindern, wobei die Klinik oft nicht in der Nähe des Wohnortes der Familie lag. Für Außenstehende war aufgrund der Seltenheit von Transplantationen auch kaum nachvollziehbar, in welcher belastenden Situation sich die Familien befanden. Eine adäquate Unterstützung war somit schwer möglich.
Bei einem großen Teil der Eltern führte die ständige Angst vor gesundheitlichen Komplikationen auch noch Jahre nach der Transplantation zum sozialen Rückzug, da ihre Angst entweder in ihrem sozialen Umfeld nicht thematisiert wurde oder sie sich von Bekannten und Freunden unverstanden fühlten.
Mutter: „Ich bin enttäuscht von meinen eigenen Leuten. Denn als das war, kam jeder angerannt, aber nur, um die Neugierde zu befriedigen. Und dann, als das dann rum war, ist es ganz abgestorben. (...) Aber jetzt erwarte ich das auch nicht mehr. Anscheinend ist das schwer zu verstehen: Das Leben geht weiter und die Angst bleibt ja trotzdem.”
Alle Eltern schilderten uns, dass die intensive Zuwendung und Verbindlichkeit der Ärzte mit dem Ende des Krankenhausaufenthaltes deutlich abnahm. Diejenigen Eltern, die aufgrund mangelnder Verfügbarkeit eines stützenden sozialen Netzes auf die hohe Aufmerksamkeit der Ärzte angewiesen blieben, erlebten dies mit Enttäuschung und dem Gefühl, von den Ärzten fallengelassen worden zu sein. Andere Eltern, die sich auch während des Transplantationsprozesses ein soziales Netz außerhalb der Klinik erhalten hatten, konnten deutlich besser damit umgehen und äußerten Verständnis für das Verhalten der Ärzte.
Vor allem diejenigen Eltern, für die die Ärzte auch lange nach der Transplantation eine zentrale Rolle spielten, versuchten, den vermuteten Ansprüchen der Ärzte, ein „normales” Leben führen zu können, gerecht zu werden. Dies stand teilweise in deutlichem Widerspruch zu den Bedürfnissen ihrer Kinder. Dabei wurde versäumt, eine neue „Normalität” herzustellen, die die Anforderungen chronischer Krankheit miteinbezieht, was zu zusätzlicher Hilflosigkeit und Unzufriedenheit mit der aktuellen Lebenssituation führte.
Zusätzlich zu den oben skizzierten Faktoren förderte die Erfahrung, der voranschreitenden Erkrankung des Jugendlichen hilflos gegenübergestanden zu haben, die Abhängigkeit vieler Eltern von den Ärzten der Transplantationsklinik. In ihrer Wahrnehmung waren die Ärzte, an die sie sich zunächst wandten (überwiegend Haus- oder Kinderärzte), nicht in der Lage, die Krankheit angemessen zu diagnostizieren und in ihrer Dramatik adäquat einzuschätzen. Stattdessen hätten sie ihnen das Gefühl vermittelt, sie seien zu Unrecht besorgt über den für die Eltern offensichtlichen Abbau der körperlichen Kräfte des Jugendlichen.
Im Transplantationszentrum fanden diese Eltern zum ersten Mal adäquate Hilfe. Die kompetente Arbeit der medizinischen Spezialisten erlebten alle befragten Eltern als Rettung und reagierten mit großer Dankbarkeit.
Daraus folgte bei einigen Eltern die vollständige Übertragung der Verantwortung für den Zustand des Kindes an die Ärzte. Hier fanden wir eine besonders starke Angst und Unsicherheit im Umgang mit den Kindern nach dem Klinikaufenthalt, da die Eltern sich zu sehr auf das medizinische Expertentum der Ärzte verlassen hatten. Außerdem hatten sie keine eigene Kompetenz und vor allem kein Selbstvertrauen im Umgang mit der Krankheit erlangt. Diejenigen Eltern jedoch, die auch während der Zeit im Krankenhaus in der Verantwortung für ihre Kinder geblieben waren und eigene Erfahrungen mit ihren Kindern genauso ernst nahmen wie das medizinische Fachwissen der Ärzte, schienen später deutlich zufriedener und kompetenter in der täglichen Lebensführung mit ihrem transplantierten Kind.
Die Relevanz psychologischer Betreuung
Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein guter postoperativer Gesundheitszustand für die Betroffenen nicht der ausschließliche Indikator für einen Behandlungserfolg ist. Vielmehr scheinen die psychosozialen Belastungen, die infolge der Transplantation entstehen, von mindestens ebenso großer Relevanz für die Beurteilung der postoperativen Lebenssituation zu sein.
So bleibt für die Jugendlichen die Integration in die Gruppe der Gleichaltrigen und die Loslösung vom Elternhaus deutlich erschwert. Auch die Erfahrung der frühen Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod bleibt für die Jugendlichen ein belastender Bestandteil ihres Lebens.
Für viele Eltern bedeutet die Bewältigung ihrer derzeitigen Lebenssituation eine Überforderung. Mangelndes medizinisches Wissen, unrealistische Erwartungen an die Zeit nach der Transplantation, eine mangelnde Verfügbarkeit sozialer Unterstützung und eine hohe Abhängigkeit von den Ärzten wirken hier verstärkend.

Es erscheint daher sinnvoll, im ärztlichen Beratungsgespräch noch stärker als bisher auch die soziale Lebenssituation und Ängste der Betroffenen zu thematisieren und auf die Gefahr psychosozialer Belastungen frühzeitig und eindringlich hinzuweisen. Dazu könnten neben dem Gespräch auch schriftliche Informationen dienen. Den Familien wird so eher ermöglicht, ihren Ängsten Ausdruck zu verleihen und entsprechende Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen.
Eltern sollten als Zielgruppe psychologischer Interventionen verstärkt berücksichtigt werden, da sie von zentraler Bedeutung für die transplantierten Jugendlichen sind. Dabei sollte vor allem darauf geachtet werden, unrealistische Vorstellungen vom Leben nach der Transplantation schon vor der Operation zu korrigieren.
Die Bildung von Netzwerken transplantierter Jugendlicher, möglicherweise mit Hilfe des Internets, sollte schon in der Klinik unterstützt werden. Da die Jugendlichen nach Aussage vieler Eltern schwer zur Teilnahme an psychologischen Gesprächsgruppen außerhalb der Klinik zu motivieren sind, wäre die Einrichtung von „Chatrooms” unter Teilnahme eines psychologischen Experten eine Alternative.
Eine umfassende Betreuung der Familien erfordert eine intensive Zusammenarbeit von Ärzten und Professionellen aus dem psychosozialen Bereich. Dabei sollte die psychologische Betreuung der Patienten und ihrer Familien eine ebenso große Relevanz haben wie die medizinische, um die langfristige Anpassung der Familien an die neue Lebenssituation zu ermöglichen.

Sämtliche Maßnahmen sollten das Ziel verfolgen, eine übermäßige Abhängigkeit der Eltern von den Ärzten zu vermeiden und sie stattdessen in die Lage versetzen, während des gesamten Transplantationsprozesses mitverantwortlich für den Genesungsprozess ihrer Kinder zu bleiben. Auf diese Weise wird es ihnen nach dem Klinikaufenthalt leichter fallen, aktiv und kompetent die neue Lebenssituation gemeinsam mit ihren Kindern zu bewältigen.
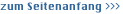
|